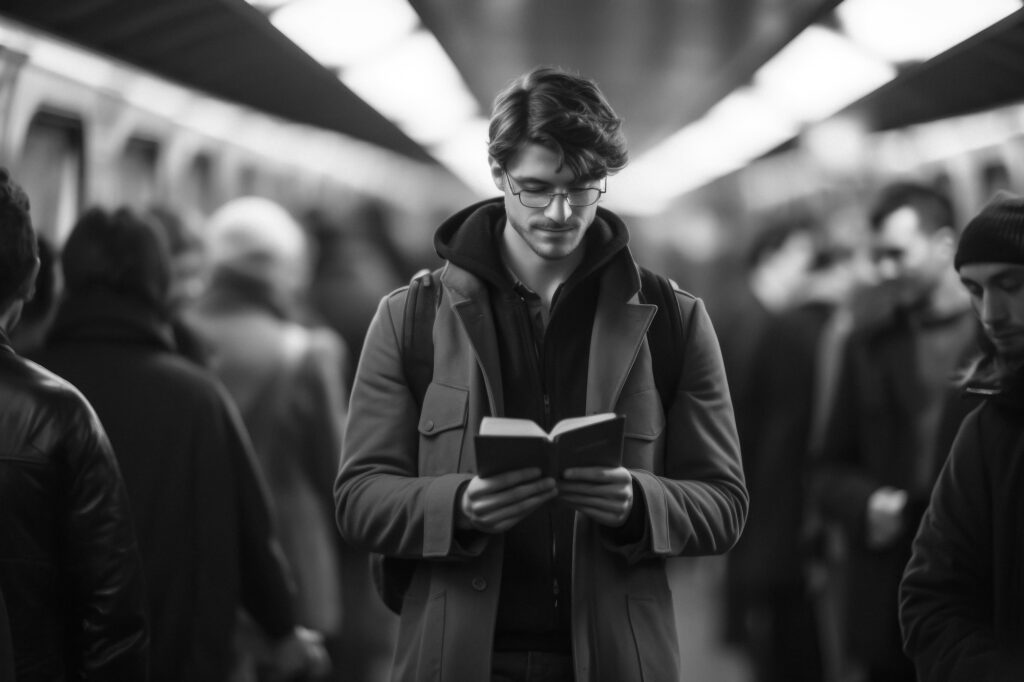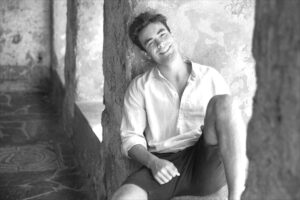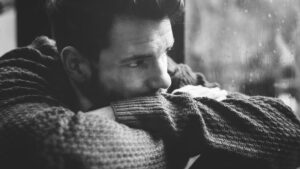Am vergangenen Wochenende saß ich bei einem Abendessen, als jemand beiläufig erwähnte, dass Goethe auch Staatsminister war. Die Runde verstummte kurz – nicht aus Ehrfurcht, sondern aus Unwissen. Niemand wusste, was er damit anfangen sollte. Einer griff zum Handy, um zu googeln. Der Moment war vorüber.
Es war einer dieser kleinen Augenblicke, die zeigen, wie sehr sich unser Verhältnis zum Wissen verändert hat. Früher hätte dieser Satz ein Gespräch entfacht. Heute beendet er eines.
Das Ende der schönen Nutzlosigkeit
Allgemeinbildung ist zu einem nostalgischen Begriff geworden, wie „Anstandsregeln“ oder „Sonntagsanzug“.
Etwas, das unsere Großeltern noch kannten, das aber heute seltsam antiquiert wirkt. Wir haben es ersetzt durch Spezialisierung, durch gezieltes Wissen, durch das, was uns unmittelbar nützt.
Das ist nicht völlig verkehrt. Niemand kann heute noch alles wissen. Die Wissensexplosion der letzten Jahrzehnte hat den klassischen Bildungskanon gesprengt. Wer Quantenphysik versteht, muss nicht zwangsläufig Schiller zitieren können. Wer sich in der Weltliteratur auskennt, muss keine Ahnung von Blockchain haben.
Und doch ist da ein Verlust. Nicht der Verlust von Fakten – die stehen ja alle im Internet. Sondern der Verlust von Verbindungen.
Warum Zusammenhänge wichtiger sind als Fakten
Allgemeinbildung war nie nur Faktenwissen. Sie war ein Navigationssystem für komplexe Zusammenhänge.
Wer wusste, dass die Romantik eine Reaktion auf die Aufklärung war, verstand auch, warum Menschen heute wieder nach dem Irrationalen suchen. Wer die Geschichte des Römischen Reichs kannte, erkannte Muster in modernen politischen Entwicklungen.
Diese Art des vernetzten Denkens ist selten geworden. Wir haben Experten für alles, aber kaum noch Menschen, die die großen Linien ziehen können. Wir wissen unendlich viel über Einzelheiten und erstaunlich wenig über die Art, wie diese Einzelheiten zusammenhängen.
Das zeigt sich in unseren Gesprächen.
Früher konnte man von Mozarts Lebenslauf zu den politischen Umwälzungen seiner Zeit springen, von dort zur Philosophie der Aufklärung und wieder zurück zur Musik. Heute führen solche Sprünge ins Leere. Wir reden aneinander vorbei, weil uns die gemeinsamen Referenzpunkte fehlen.
Die Google-Falle
„Ich kann das ja schnell nachschauen“, ist zum Totschlagargument geworden. Warum sollte man sich Namen, Daten oder Zusammenhänge merken, wenn sie jederzeit abrufbar sind?
Die Rechnung geht nicht auf. Wissen, das nur in Einzelteilen abgerufen wird, bleibt zusammenhanglos.
Wer Mozart nur googelt, wenn er ihn gerade braucht, verpasst die hundert kleinen Momente, in denen Mozart-Wissen ein Gespräch bereichern könnte. Allgemeinbildung entsteht nicht durch gezieltes Nachschlagen, sondern durch das zufällige Wiedererkennen von Mustern.
Dazu kommt: Was wir nicht im Kopf haben, können wir nicht spontan verknüpfen. Kreativität entsteht oft durch die unerwartete Verbindung scheinbar unzusammenhängender Dinge. Wer sein Wissen auslagert, lagert auch seine Kreativität aus.
Der Preis der Spezialisierung
Unsere Kultur der Hyper-Spezialisierung hat einen hohen Preis.
Wir haben brillante Fachidioten hervorgebracht, aber kaum noch Menschen, die über den Tellerrand schauen können. Wir lösen technische Probleme mit atemberaubender Präzision, aber verstehen oft nicht ihre gesellschaftlichen Auswirkungen.
Ein Software-Entwickler, der noch nie von den Weberaufständen gehört hat, wird die sozialen Folgen der Automatisierung anders einschätzen als einer, der die Geschichte der Industrialisierung kennt. Ein Politiker, der nicht weiß, wie Demokratien in der Vergangenheit gescheitert sind, wird andere Entscheidungen treffen als einer, der diese Muster erkennt.
Allgemeinbildung war immer auch Orientierungshilfe. Sie half dabei, die eigene Zeit zu verstehen, indem sie sie in einen größeren Kontext stellte.
Die Rückkehr zur Neugier
Vielleicht brauchen wir eine neue Definition von Allgemeinbildung. Nicht als starren Kanon von Fakten, die man auswendig lernt, sondern als Haltung der offenen Neugier.
Als Bereitschaft, Verbindungen zu suchen, auch wenn sie nicht unmittelbar nützlich scheinen.
Das bedeutet nicht, dass jeder Goethe gelesen haben muss. Aber es bedeutet, dass wir wieder lernen sollten, Fragen zu stellen, die über unser direktes Fachgebiet hinausgehen. Dass wir uns trauen, auch mal über Dinge zu sprechen, von denen wir nur halb so viel verstehen, wie wir gerne würden.
Die schönsten Gespräche entstehen oft an den Rändern unseres Wissens. Dort, wo wir gemeinsam nach Antworten suchen, statt sie voneinander zu erwarten.
Eleganz des Unwissens
Paradoxerweise gehört zur neuen Allgemeinbildung auch der elegante Umgang mit Unwissen.
Die Fähigkeit zu sagen: „Das weiß ich nicht, aber es erinnert mich an…“ Oder: „Davon verstehe ich wenig, aber könnte es sein, dass…“
Diese Art der intellektuellen Bescheidenheit ist heute seltener als Expertenwissen. Aber sie ist es, die Gespräche am Leben hält und Menschen zusammenbringt.
Allgemeinbildung war nie Angeberei. Sie war ein Geschenk an das Gespräch. Ein Angebot, gemeinsam über die Welt nachzudenken, statt sich gegenseitig mit Fachwissen zu erschlagen.
Vielleicht ist das der Grund, warum sie aus der Mode gekommen ist: In einer Zeit, in der jeder Experte für etwas ist, haben wir vergessen, wie schön es sein kann, gemeinsam Anfänger zu bleiben.